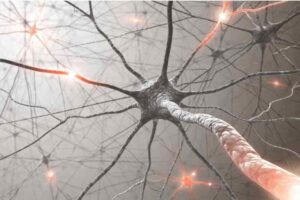Trauma und Diagnosen – ein kontroverses Thema. Für den einen kann es ein Segen sein, wenn das eigene Leid anerkannt wird. Für manch andere bedeutet es zusätzlichen Schmerz, mit mehr oder weniger präzisen Diagnosestellungen und deren Konsequenzen fertig werden zu müssen.
Viele Menschen sind traumatisiert und wissen es nicht. Denn Traumafolgen zeigen sich nicht immer nur in der Psyche, sondern häufig auch über den Körper.
Andere wissen um ihre Traumatisierung, bekommen aber keine passende Diagnose und damit auch oft keine adäquate Therapie.
Hinzu kommt, dass Psycho-Diagnosen häufig mit Stigmatisierung und damit auch Scham einhergehen. Das führt dazu, dass viele Menschen ihr Leid lieber verstecken, als damit sichtbar zu werden. Dies wirkt sich nicht nur auf sie selbst, sondern auch auf ihr Umfeld aus – und kann damit selbst im gesellschaftlichen Rahmen beachtliche Konsequenzen haben.
In diesem Blogartikel beleuchte ich das Thema Diagnosen aus mehreren Perspektiven.
Trauma und Diagnosen – Last oder Erleichterung?
Für manche Menschen kann eine Diagnose entlastend sein. Denn sie werden in ihrem Leid gesehen und haben Aussicht auf eine angemessene Behandlung.
Gerade wenn eine Person in Bezug auf den eigenen Schmerz nicht ernst genommen wurde, kann es sehr heilsam sein, wenn das Leid gewürdigt und adäquate Unterstützung bereitgestellt wird.
Andere Menschen bekommen eine Diagnose, welche körperliche Symptome beschreibt, ohne mögliche darunterliegende Traumafolgen zu berücksichtigen. Dann erfolgt meist eine rein symptombezogene Therapie, ohne die traumatischen Ursachen zu adressieren. Das sorgt oft dafür, dass sich die Situation der Betroffenen lange nicht verändert.
Ebenso kann eine Diagnose auch stigmatisierend sein, wenn die betroffene Person über ihre (nicht immer stimmige) Diagnose identifiziert wird. Und oft genug wird die Therapie primär auf diese Diagnosestellung abgestimmt und nicht auf das aktuelle Erleben der Person.
Gerade psychische Diagnosen haben eine sehr lange Halbwertszeit. Einmal gestellt, bleibt die Diagnose in der Krankenakte – manchmal ein Leben lang. Denn viele Ärzte oder Psychologen übernehmen die Diagnosen einer Vorbehandlerin, ohne sie zu hinterfragen. Doch warum ist das so?
Diagnosestellung in Psychologie und Psychiatrie
Diagnosestellung im Bereich der geistigen Gesundheit ist eine vertrackte Sache. Damit die Krankenkasse eine entsprechende Therapie bezahlt, muss ein Befund festgestellt werden.
Ein Arzt oder eine Psychologin benennt das, was Du erlebst, als Diagnose X oder Y. Im Grunde ist die Diagnose eine Bezeichnung, ein Etikett für Dein Erleben.
Da die Psyche jedoch keine klar zu messende Größe ist, gibt es in der Befundung einen gewissen Interpretationsspielraum.
Häufig werden Diagnosen dabei so gestellt, dass möglichst viele Therapiestunden erstattet werden. Nicht immer entsprechen diese angepassten Diagnosen deiner tatsächlichen Verfassung.
Manchmal bewirkt das auch, dass sich Menschen entsprechend dieser Diagnose zu verhalten beginnen. Wenn sie sich mit der Diagnose identifizieren, entdecken sie an sich zahlreiche Symptome und Verhaltensweisen, die mit der gestellten Diagnose einhergehen.
Mögliche Diagnosen bei Trauma
Bei Traumatisierungen kann eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder Anpassungsreaktion diagnostiziert werden. Dies sind Reaktionen, die durch überwältigende Lebensereignisse entstehen können.
Doch viele Menschen, die Traumafolgen tragen, haben nicht alle Symptome, welche die Kriterien für die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung erfüllen. Gerade bei Menschen mit Entwicklungs- und Bindungstrauma ist dies häufig der Fall.
Dementsprechend erhalten sie dann auch keine traumaspezifische Therapie – weil sie im Alltag „funktionieren“. Zum Thema Hochfunktionalität habe ich einen separaten Blogartikel geschrieben.
Die Auswirkungen zeigen sich bei ihnen anders. Auch Ängste, Panik, Zwänge, Essstörungen oder Veränderungen der Stimmungslage (z. B. Depressionen oder eine Bipolare Störung) können ein traumatisches Erleben als Grundlage haben. Sie können gut behandelt werden, wenn die Behandlerin einen möglichen Traumahintergrund im Blick hat.
Einen großen Anteil an Traumafolgen machen auch die Suchterkrankungen aus – unabhängig davon, ob sie sich auf Substanzen oder Verhaltensweisen beziehen.
Bei den sogenannten Psychosen wie wahnhaften Störungen oder Schizophrenie erkennen die Betroffenen selbst nicht, wie belastet sie sind. Denn sie sind dazu nicht ausreichend in der Realität verankert.
Gelegentlich werden auch Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, vordergründig bei Menschen, die schon früh im Leben traumatisierende Erlebnisse hatten.
Persönlichkeitsstörungen gelten als schlecht therapierbar. Daher kann es problematisch werden, eine entsprechende Behandlerin zu finden, denn nicht alle Therapeuten behandeln Persönlichkeitsstörungen.
Es ist häufig sinnvoll, eine Diagnose kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, ob es sich um eine „angepasste“ Diagnose handelt. Manchmal ist es auch hilfreich, ggf. eine zweite (oder auch dritte) Meinung einzuholen.
Komplexes Trauma und Diagnosen
In der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (kPTBS) kommen Schocktraumata in der frühen Kindheit mit Entwicklungstrauma zusammen. Mehr über verschiedene Arten von Trauma kannst du im entsprechenden Blogartikel lesen.
Bisher galt als Diagnostikleitfaden der ICD 10 (International Classification of Diseases). Er enthielt keine Diagnose der komplexen PTBS. Menschen mit komplexen Traumafolgen erhielten daher umschreibende Diagnosen, um eine Therapie zu bekommen.
Im neuen diagnostischen Manual, dem ICD 11, das ab 2025 verfügbar ist, wird auch die komplexe posttraumatische Belastungsstörung genannt. Allerdings ist sie so definiert, dass die Betroffenen mindestens das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung erfüllen müssen und zusätzlich noch weitere Symptome.
Diese Definition wird aber der Tatsache nicht gerecht, dass viele Menschen, die unter komplexen Traumafolgen leiden, im Alltag hochfunktional sind und nicht alle (oder auch keine) Symptome der PTBS zeigen.
Damit erhalten sie diese Diagnose auch nicht – ebenso wenig wie ein traumaspezifisches Therapieangebot. Insofern ist es fraglich, ob der ICD 11 wirklich besser auf Menschen mit komplexem Traumahintergrund eingeht.
Eine kritische Würdigung dieses Sachverhalts von der Traumapionierin Luise Reddemann findest du in einem Artikel in der Psylife Was bringt uns der ICD11?
Ist es sinnvoll, Diagnosen zu hinterfragen?
Wenn du dein Verhalten, deine Befindlichkeit in einer Diagnose nicht wiedererkennst, ist es sinnvoll, das anzusprechen. Denn die Kriterien für psychische Diagnosen sind oft nicht klar voneinander abgegrenzt.
Somit gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum, der es möglich macht, dass verschiedene Behandler unterschiedliche Meinungen zu Deinem Erleben haben – und zu unterschiedlichen Befunden kommen.
Insbesondere wenn Diagnosen durch persönliche Einschätzung gewonnen werden, können Therapeuten auch einmal daneben liegen.
Wenn du mit deiner Behandlerin nicht übereinkommst, konsultiere einen weiteren Behandler. Denn eine Diagnose hat nicht nur für die Auswahl der passenden Therapie Konsequenzen.
Die Auswirkung von Diagnosen
Wenn einmal eine Diagnose gestellt wurde, damit du therapeutische Unterstützung bekommst, bleibt diese in der Krankenakte. Auch wenn es dir längst wieder besser geht, wirst du nicht „gesundgeschrieben“.
Das wirkt sich auch im Alltag aus. Wenn du etwa eine private Krankenversicherung oder Lebensversicherung abschließen willst, wird deine Krankengeschichte abgefragt. Mit der entsprechenden Diagnose wie einer Depression oder Ängsten kann der Abschluss unter Umständen schwierig werden.
Trauma und somatische Diagnosen
Nicht immer reagiert ein Mensch mit veränderten Verhaltensweisen auf eine traumatische Situation und den darauffolgenden chronischen Stress. Oft ist es der Körper, der anzeigt, dass etwas nicht stimmig ist. Viele Menschen mit körperlichen Diagnosen sind traumatisiert und wissen es nicht.
In der psychosomatischen Medizin gibt es eine Bezeichnung für psychische und emotionale Ungleichgewichte, die sich nicht über die Stimmung, sondern über den Körper ausdrücken – es heißt dann, die Menschen somatisieren.
Auch psychosomatische Symptome (wie Erschöpfung, chronische Schmerzen, Magen-/Darmbeschwerden, Herz-/Kreislaufbeschwerden) sind in der Regel Ausdruck von chronischem Stress. Häufig liegt ihnen ein frühes Trauma zugrunde.
Bei Krankheiten wie Asthma oder Autoimmunerkrankungen oder Diabetes kann ebenfalls ein unverarbeitetes Trauma die Ursache für den chronischen Stress sein.
Wird dies jedoch nicht erkannt und in den Behandlungsprozess einbezogen, bleibt die Therapie eine rein symptomatische Behandlung des Körpers, welche die tieferen Ursachen der Symptome nicht adressiert – mit oft mäßigem Erfolg. Keine Therapie scheint effektiv zu wirken, obwohl auf der körperlichen Ebene alle Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft werden.
Wenn Traumafolgen als Grundlage körperlicher Erkrankungen mitbehandelt werden, können sich die somatischen Symptome oft deutlich verbessern.
Geschlechtsspezifische Diagnosen
Im Laufe meiner therapeutischen Tätigkeit habe ich festgestellt, dass Diagnosen oft geschlechtsbezogen gestellt – oder auch nicht gestellt – werden.
Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung etwa findet sich häufiger bei Mädchen und Frauen. Bei den Jungen und Männern werden häufiger AD(H)S oder Autismus diagnostiziert. Dabei sind viele Symptome identisch, werden aber je nach Geschlecht unterschiedlich bewertet.
Über die geschlechtsspezifische Deutung von emotionalem Ausdruck habe ich in meinem Beitrag über verkörperte Emotionen geschrieben.
Autismus wird bei Mädchen und Frauen häufig gar nicht oder erst im Erwachsenenalter erkannt, da er sich hier anders zeigt. Das führt dazu, dass sie die entsprechende Unterstützung auch erst sehr spät erhalten – wenn überhaupt. Dies kann erhebliche Konsequenzen für ihren Entwicklungsweg bedeuten – bis zum Trauma durch extremen Anpassungsdruck oder Mobbing.
Pathologisierung durch Diagnosen
In den diagnostischen Manualen geht die Tendenz bei den Diagnosen dahin, gewöhnliche und nachvollziehbare Prozesse zu pathologisieren, also ihnen einen Krankheitswert zu geben.
Deutlich wird dies beispielsweise beim Umgang mit Trauer. Es ist menschlich und nachvollziehbar, beim Verlust eines geliebten Menschen zu trauern. Und das braucht seine Zeit.
Früher gab das Trauerjahr den Hinterbliebenen einen Rahmen, den Verlust zu verarbeiten. Durch schwarze Kleidung zeigten sie der Welt, dass sie in einem Trauerprozess waren.
Doch wenn heutzutage die Trauer länger als zwei Wochen (!) andauert, kann laut ICD 11 bereits eine Depression diagnostiziert werden.
Damit bekommen natürliche und zutiefst menschliche Prozesse plötzlich Krankheitswert. Wer „zu lange“ nicht funktioniert, wird pathologisiert. Welchen Nutzen hat das? Und welche Konsequenz folgt daraus?
Wenn wir als krank gelten, sobald wir eine menschliche Regung zeigen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine professionelle Unterstützung suchen – und eher mit unserem Schmerz alleine bleiben.
Diagnosen und Stigma
Diagnosen, wenn sie nicht passend sind oder für sie möglicherweise keine (passende) Therapiemöglichkeit besteht, bieten viel Potenzial zur Scham.
Während Menschen mit Knochenbrüchen oder Diabetes offen über ihre Erkrankungen sprechen und dadurch (therapeutische und menschliche) Zuwendung bekommen, ist dies häufig bei Personen mit psychischen Diagnosen nicht der Fall.
Wenn die Gefahr besteht, die Arbeit oder bedeutsame Kontakte zu verlieren, verstecken viele Betroffene ihre Situation und isolieren sich.
Unser inneres Erleben, wenn es mit Stigma wie einer entsprechenden Diagnose belegt ist, kann also auch dafür sorgen, dass wir uns damit alleine fühlen.
So finden wir aber nicht das, was wir zur Heilung und Integration am meisten benötigen – das Gefühl der Verbundenheit und des Aufgehobenseins in einem größeren Rahmen.
Umgang mit psychischen Ungleichgewichten in unterschiedlichen Kulturen
In unserer Kultur wird eine seelische Befindlichkeit (hier oft mit dem Etikett einer Psycho-Diagnose belegt) als persönliche Angelegenheit betrachtet.
Die meisten Verletzungen entstehen durch einen Mangel an Verbundenheit und Einstimmung im Alltag. Fehlen diese Ressourcen im täglichen Leben, wie es in unserer schnelllebigen, komplexen und unvorhersehbaren Welt häufig vorkommt, können individuelle Therapien als alleiniger Ansatz nur bedingt wirken.
Außerdem bleibt das (trauma)therapeutische Angebot leider weit hinter dem tatsächlichen Bedarf zurück. Hier wiederholt sich für viele Betroffene die Frustration, mit dem eigenen Leid alleine zu sein.
Gibt es im Alltag hingegen genug Ressourcen, bedarf es oft keiner Therapie für Menschen in belastenden Situationen.
In Kulturen, welche dysregulierte Menschen nicht isolieren, sondern einbinden, sind die Heilungschancen (etwa für Menschen mit Psychose) doppelt so hoch wie in unserem Kulturkreis. So eindrucksvoll benennt es John Read, PhD Professor of Clinical Psychology in der University of Technology in Swinburne, Neuseeland, in dem Film Crazywise.
Ein größerer Rahmen, in dem sich Menschen aufgehoben fühlen und wirken können, ist eine nicht zu unterschätzende Größe für den Heilungsprozess.
Identifikation mit der Diagnose – Hinwendung zum Defizit
Viele Diagnosen enthalten das Wort Störung – was nicht unbedingt zur Ermutigung der Betroffenen beiträgt. Denn wer will schon als gestört gelten? In der Alltagssprache wird der Begriff sehr abwertend gebraucht.
Wenn Menschen immer wieder durch die diagnostische Brille als Depressive, Borderliner, Angstpatienten etc. wahrgenommen werden (oder sich selbst so betrachten), verhalten sie sich auch zunehmend diesem Bild entsprechend. Denn die Energie folgt der Aufmerksamkeit.
Durch die Überbetonung ihrer „Defizite“ identifizieren sie sich mit der Diagnose und passen ihr Erleben entsprechend an. Darüber verlieren sie manchmal den Blick auf das Unversehrte und Heile in sich.
Dies kann auch dazu führen, dass sie resignieren und den Blick auf neue, andere Perspektiven verlieren. Wie schade ist es, wenn das, was unterstützen soll, genau in die andere Richtung führt!
Kontakt mit der inneren Kraft – Hinwendung zum Unversehrten
Auch wenn du therapeutische Unterstützung in Anspruch nimmst und jemand deshalb einen Befund geschrieben hat: Du bist weit mehr als deine Diagnose. Du bist ebenso heil und unversehrt.
Du bist, was du erlebst – und in jedem Moment hast du die Gelegenheit, dein Erleben neu zu gestalten. Manchmal in kleinen Schritten, manchmal in größeren.
Immer gibt es dabei auch Ressourcen. Denn ohne sie wärest du gar nicht bis hier gekommen. Was hat dich getragen, welche Fähigkeiten sind auf deinem Weg entstanden? Und was trägt dich jetzt?
Wenn du dich dem inneren heilen Kern und deinen Ressourcen zuwendest, bekommen sie mehr Wirkkraft in deinem Alltag. Dann helfen sie dir, das Belastende zu integrieren.
Den Prozess offenhalten und beides integrieren
Eine gewisse Neugier für dein inneres Gleichgewicht zu wecken, ist ein wesentliches Element auf dem Heilungs- und Integrationsweg. Was habe ich erlebt? Wie habe ich das damals erlebt? Wie geht es mir jetzt damit? Was wünsche ich mir zu erleben? Welche Wege dahin erscheinen mir gangbar? Wo kann ich gerade wirken und mir etwas Gutes tun?
In meiner Arbeit kann ich dich unterstützen, mit einem wohlwollenderen, weniger bewertenden Blick auf dich zu schauen und Antworten auf diese Fragen zu finden.
Wenn du Interesse daran hast, dein inneres Erleben zu erkunden, schau dir gerne mein Angebot an.
Bildnachweis
Psychologin macht Notizen –