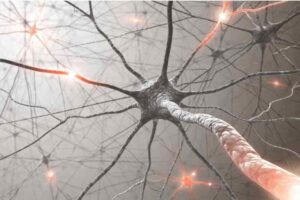Medizinisches Trauma wird oft nicht als solches erkannt. Doch auch scheinbar kleine Eingriffe und ungünstige Rahmenbedingungen können dazu führen, dass sich im Rahmen einer Erkrankung und ihrer Therapie – oder auch danach – Trauma-Symptome zeigen.
Wenn diese frühzeitig erkannt und / oder möglichst gute Rahmenbedingungen geschaffen werden, begünstigt das den Heilungsprozess der Betroffenen. Wie es gelingen kann, warum dies leider häufig nicht der Fall ist und welche Konsequenzen das hat, beleuchte ich in diesem Beitrag.
Ich möchte hier eine Grundlage schaffen, damit Menschen, die einen medizinischen Eingriff vor oder hinter sich haben, möglichst viel Information und Orientierung finden, welche Folgen damit einhergehen können – und wie sie damit bestmöglich umgehen können.
Daher werde ich auch einige Beispiele von potenziell traumatisierenden Situationen beschreiben (ohne dabei ins Detail zu gehen). Bitte prüfe daher für dich, ob du diesen Artikel lesen willst oder lieber nicht.
Was ist ein medizinisches Trauma?
In der Medizin gibt es zwei Definitionen von Trauma. Zum einen versteht man darunter eine körperliche Verletzung (zum Beispiel in der Sporttraumatologie). Zum anderen gibt es die Psychotraumatologie, die sich mit der seelischen Verarbeitung überwältigender Prozesse beschäftigt.
In diesem Blogartikel geht es darum, welche Situationen im medizinischen Kontext häufig zu chronischem Stress, also zu Traumasymptomen führen können. Dabei betrachte ich Trauma weder als rein körperlich noch als rein psychisch. Denn beide Bereiche sind über das vegetative Nervensystem eng miteinander verknüpft und reagieren gemeinsam auf überwältigenden Stress.
Medizinisches Trauma wird oft übersehen
Medizinische Untersuchungen gehören zu unserem Alltag. Es gibt in unserer Kultur nur sehr wenige Menschen, die noch nie beim Arzt oder im Krankenhaus waren.
Leider führt diese Normalität der (manchmal auch leidvollen) Prozeduren dazu, dass die Folgen medizinischer Eingriffe oft nicht als solche erkannt werden. Dann werden andere Ursachen für eventuelle unerklärliche Symptome gesucht.
Doch warum bergen medizinische Eingriffe ein Risiko für Traumafolgen, wo sie doch eigentlich zur Heilung beitragen sollen?
Risikofaktoren für medizinisches Trauma
Wie ich bereits in meinem Blogartikel Was ist Trauma beschrieben habe, entsteht ein Trauma dann, wenn ein Mensch sich in einer Situation befindet, aus der er mit seinen eigenen Handlungsmöglichkeiten nicht hinausfindet.
Dies hinterlässt ihn in einem Zustand der Ohnmacht und Hilflosigkeit, was den Stress im Körper gleichsam „einfriert“. Damit können dann vielfältige Symptome entstehen.
Je größer die Angst und je geringer die eigene Handlungsmacht ist, desto höher ist also das Risiko für eine Traumatisierung. Krankheit und Schmerzen aktivieren unsere Überlebensreaktionen.
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen befinden sich bereits in einem Zustand erhöhter Verletzlichkeit und Verunsicherung. Denn sie wissen oft nicht, warum ihr Körper so reagiert, wie er es tut.
Manchmal sind sie auch nicht bei Bewusstsein und haben somit keinerlei Kontrolle über das, was mit ihnen geschieht. Das verstärkt ihre Ohnmacht, und die gesamte Handlungsmacht geht zum medizinischen Personal über.
Hinzu kommt, dass viele medizinische Eingriffe zwar notwendig sind, aber rein körperlich dennoch Grenzverletzungen darstellen. Dazu später mehr.
Last, but not least fehlt es Ärzten, Therapeuten und Pflegepersonal häufig an Zeit und Ressourcen, um mitfühlend auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen.
Die Abläufe in vielen Kliniken und Praxen sind oft sehr stark funktionalisiert. Sie lassen wenig Raum für menschliche Begegnung und Flexibilität. Leider geht dies auch zulasten der Patienten. So fehlt es oft an Co-Regulation für die Patienten in der Zeit erhöhter Verletzlichkeit.
Angst begünstigt medizinisches Trauma
Ein hohes Risiko für medizinisches Trauma bieten Zustände, die mit Todesangst einhergehen sowie Nahtod-Erfahrungen. Einige Beispiele hierfür sind ein anaphylaktischer Schock, eine Vergiftung, ein Schlaganfall oder Herzinfarkt.
Wenn Erstickungsgefahr besteht oder Patienten reanimiert werden müssen, erhöht dies ebenfalls das Risiko. Doch auch extreme Schmerzen, hohes Fieber und Infektionen gehen oft mit Todesängsten einher.
Notfallmedizin
Gerade in der Notfallmedizin müssen schnell Entscheidungen getroffen werden. In diesen Situationen ist es wegen der lebensbedrohlichen Situation nicht möglich, den Patienten ausreichend aufzuklären oder sein Einverständnis einzuholen. Dies gilt auch für Not-Operationen.
Auch wenn die Patientin nicht bei Bewusstsein ist, registriert der Körper, was geschieht – und wertet es oft als Bedrohung.
Hinzu kommt, dass Menschen manchmal nicht sofort versorgt werden können, zum Beispiel nach einem Unfall oder wenn sie sehr abgelegen wohnen. Dann müssen sie auf die Rettung warten, was unter Umständen die Angst verstärkt.
Operationen
Selbst wenn Operationen geplant werden können und oft notwendig oder gar lebenserhaltend sind, stellen sie doch auf der körperlichen Ebene eine Grenzverletzung dar. Sie gehen buchstäblich unter die Haut.
Auch wenn der Eingriff unter Narkose stattfindet, wird doch das gesamte Geschehen körperlich erlebt und im Körpergedächtnis gespeichert.
Der Körper unterscheidet nicht zwischen Säbelzahntiger und Skalpell und reagiert instinktiv mit Kampf- oder Fluchtimpulsen, die aber nicht vollendet werden können.
Siehe hierzu auch meine Blogbeiträge über Stress, Trauma und das Gedächtnis und die Neurobiologie von Stress und Trauma. Was genau in der Narkose passiert, beschreibe ich später noch.
Intensivmedizin – High Tech am Menschen
Die Intensivmedizin mit ihren hochtechnischen Maßnahmen zur Überwachung und Erhaltung der Vitalfunktionen ist oft sehr segensreich.
Dennoch bleibt ein Aufenthalt auf der Intensivstation für einige Patienten nicht ohne Folgen. Sie leiden dann am sogenannten Post Intensive Care Syndrome (PICS), das umfangreiche körperliche und seelische Symptome umfassen kann.
Besonders wenn sie künstlich beatmet werden oder im (künstlichen) Koma liegen, können sich auch Monate später noch vielfältige Symptome zeigen.
Auch die relativ häufige Sedierung der Intensivpatienten verstärkt deren Ohnmachtsgefühle und beschneidet ihre Mitbestimmung und Autonomie. Einige Kliniken verzichten bereits – so weit es möglich ist – auf Beruhigungsmittel, um den Patientinnen ein Maximum an Mitbestimmung zu vermitteln.
Kleiner Routineeingriff, große Auswirkungen
Doch nicht nur große Operationen können traumatisierend sein. Häufig sind es die Folgen scheinbar „kleiner Routineeingriffe“, deren Folgen nicht entsprechend zugeordnet werden.
Hierzu gehören zuallererst Untersuchungen und Eingriffe in der Mundhöhle mit ihrer räumlichen Nähe zum zentralen Nervensystem. Der Zahnarztbesuch ist für viele Menschen so unbeliebt, weil er mit instinktiver Angst vor Schmerz einhergeht.
Doch auch andere, vorwiegend invasive Standardprozeduren wie Magen- oder Darmspiegelungen tragen das Potenzial zur Retraumatisierung in sich.
Wiederholte schmerzhafte Therapien können ebenfalls ein sequenzielles Trauma auslösen.
Medizinisches Trauma kann verwechselt werden
Eingriffe im Beckenbereich (auch „ kleinere“ Prozeduren wie Katheter, Zäpfchen o. Ä.) können sich unter Umständen ähnlich auswirken wie ein sexueller Übergriff – insbesondere, wenn Kinder betroffen sind und vielleicht währenddessen noch festgehalten oder fixiert werden.
Daher ist es in der Therapie notwendig, sorgfältig zu differenzieren, worum es geht, und nicht vorzeitig Körpersignale, die auf ein Trauma im Beckenbereich hindeuten, als sexuelle Übergriffe zu interpretieren. Vorschnelle Fehldeutungen von Therapeuten können massive Konsequenzen für das weitere Leben ihrer Klienten haben.
Dennoch ist es wichtig zu bedenken, dass invasive medizinische Eingriffe ähnlich intensive Auswirkungen haben können wie sexuelle Gewalt. Häufig ist diese Tatsache nicht bewusst, und das birgt die Gefahr, das erlebte Leid zu bagatellisieren und herunterzuspielen.
Geburten und Neugeborenenversorgung
Wenn Geburten in Krankenhäusern stattfinden, werden sie der Taktung im Kreißsaal eingepasst. Für viele Gebärende bedeutet dies (Zeit-)druck, in manchen Fällen auch Mangel an Aufklärung über bevorstehende Maßnahmen. Dies begünstigt dann auch Grenzüberschreitungen durch das behandelnde Team, weil die Zustimmung der Eltern in der Kürze der Zeit nicht eingeholt wird.
Die Situation verschärft sich, wenn es Komplikationen gibt und etwa ein Notkaiserschnitt erforderlich wird. Oft ist dann nicht mehr genug Zeit für saubere Aufklärung, während die Eltern klare, ruhige und empathische Begleitung (Co-Regulation) bräuchten, um mit der für sie unvorhergesehenen Situation zurechtzukommen.
Viele Frauen, die sich eine natürliche Geburt wünschen, leiden später unter massiven Schuldgefühlen, wenn doch ein Kaiserschnitt erforderlich wurde.
Häufig wird das Neugeborene nach einer komplizierten Geburt zunächst verschiedenen Untersuchungen unterzogen und dazu von der Mutter getrennt.
Wenn es weiterer (intensiv)medizinischer Behandlung bedarf (beispielsweise nach Frühgeburten oder bei schweren Fehlbildungen, die operiert werden müssen), wird es auch länger von den Eltern getrennt.
Hier entsteht ein Bindungsbruch, der in vielen Fällen für Eltern und Kinder traumatisch ist.

Medizinisches Trauma bei Kindern
Nach einer Operation aus einer Narkose aufzuwachen, kann für Kinder sehr bedrohlich sein. Hier braucht es eine empathische Begleitung, idealerweise durch die Bezugspersonen. Auf gar keinen Fall sollte ein Kind allein sein, wenn es aufwacht.
Besonders heftig ist die Trennung von den Eltern für Kinder, die allein im Krankenhaus sind. Wenn sie krank und daher oft ängstlich sind und dann ohne die Unterstützung der Eltern medizinischen Eingriffen ausgesetzt werden, kann dies lebensverändernde Folgen haben.
Bis in die 1980er-Jahre hinein war es gängige Praxis, dass Eltern ihre Kinder im Krankenhaus abgeben mussten und nicht besuchen durften.
Für viele dieser Kinder hat dieses Erleben, von den Eltern getrennt und – bei invasiven Eingriffen – medizinisch gepiesackt zu werden, zu einer komplexen Traumatisierung geführt. Diese tief prägende Erfahrung kann auch im Erwachsenenalter deutliche Spuren in vielen Lebensbereichen hinterlassen.
Denn die Kinder fühlen sich von den Eltern verlassen, verraten und ausgeliefert. Und bei invasiven Behandlungsmethoden zusätzlich von Ärzten und Behandlern gepeinigt. Ein sehr verwandtes Gefühl also, wie es Menschen empfinden, die im näheren Umfeld emotionaler, körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind.
Die Aufarbeitung dieser Traumafolgen war damals schwierig bis unmöglich, weil es ja normal war und die Konsequenzen dieses Vorgehens nicht bewusst waren.
Glücklicherweise hat sich in den Kinderkliniken einiges verändert, und zumindest Kinder bis zum Grundschulalter dürfen heute im Krankenhaus begleitet werden (Rooming-In).
Nur ein kleiner Pieks?
Wenn Kinder vor einem Eingriff hören, dass es nicht weh tut, und anschließend Schmerz erleben, kommt dies ebenfalls einem Verrat gleich und bewirkt einen massiven Vertrauensbruch.
Verschärft wird dieses Empfinden noch, wenn Kinder während des Eingriffs festgehalten werden oder die Behandlung durchgeführt wird, obwohl das Kind in Panik ist.
Chronische Erkrankungen
Bei chronischen Erkrankungen findet der Schrecken kein Ende, und es ist offensichtlich, dass es nicht wieder gut wird. Die Angstreaktion kann nicht zum Abschluss kommen und führt u.U. zum sequenziellen Trauma.
Besonders wenn eine Erkrankung mit chronischen Schmerzen einhergeht, die nicht gelindert werden können, wirkt dies oftmals traumatisch. Chronische Schmerzen verursachen Dauerstress und machen daher mürbe.
Auch wenn eine ungünstige Prognose besteht, löst dies Ängste aus, die bestehen bleiben. Dann gilt es, mit dem erhöhten Stresslevel weiterzuleben.
Diagnoseschock
Das Mitteilen von schwierigen Diagnosen wird leider im Medizinstudium nicht explizit geschult. Daher werden Diagnosen von Ärztinnen und Ärzten oft sehr knapp und sachlich – in Form von Daten, Zahlen und Fakten – mitgeteilt.
Häufig haben Patienten (und Angehörige) keine Zeit, diese Information auch emotional zu verarbeiten und werden rasch zu – oft lebensverändernden – Entscheidungen gedrängt. Besonders von Menschen mit einer Krebserkrankung habe ich immer wieder davon gehört.
Da die Zeit der Ärzte im industrialisierten Krankenhausalltag begrenzt ist, fehlt den Patienten Mitgefühl und Co-Regulation, um diese Entscheidungen gut treffen zu können. Dies verstärkt den Stress, den die neue, oft sehr verunsichernde Situation auslöst.
Hinzu kommt, dass die Beratung zu möglichen Therapien meist sehr einseitig ausfällt und die Patienten keine Zeit haben, sich nach alternativen Möglichkeiten zu erkundigen. Ihre Autonomie und Wahlmöglichkeit werden so eingeschränkt und können Gefühle von Starre und Hilflosigkeit verstärken.
Nicht zuletzt werden je nach Geschlecht unterschiedliche Diagnosen bei gleichen Phänomenen vergeben. Teilweise werden lebensbedrohliche Erkrankungen wie ein Herzinfarkt nicht frühzeitig erkannt, weil sie sich bei Männern und Frauen unterschiedlich äußern können. Auch das kann traumatisieren. Mehr zu Diagnosen schreibe ich später in einem eigenen Artikel.
Narkose und mögliche Folgen
Für viele operative Eingriffe ist eine Narkose absolut segensreich. Dennoch gibt es einiges zu beachten, um möglichst gut damit umzugehen. Daher möchte ich einige Aspekte zu diesem Thema ausführlicher beschreiben.
Narkose und der Körper
Wie ich schon weiter oben erwähnt habe, wirkt sich eine Vollnarkose auf das Bewusstsein aus. Das heißt, in der Narkose bekommt die Person nicht bewusst mit, was geschieht. Der Körper registriert jedoch sehr wohl, was geschieht, und wertet den Eingriff wie einen Angriff. Dies aktiviert die instinktiven Überlebensreaktionen.
Nur können diese während der Narkose nicht zum Ausdruck kommen, sondern erst danach. Daher zittern, weinen oder schreien manche Menschen, wenn sie aus der Narkose aufwachen. Diese Entladung ist also eine ganz normale Reaktion, die nicht unterbunden werden sollte.
Wie sie hineingehen, so kommen sie heraus
Dieser Satz stammt aus den Feldlazaretten im 2. Weltkrieg, gilt aber nach wie vor. Je entspannter ein Mensch sich in die Narkose begeben kann, desto leichter findet er später wieder in den wach-entspannten Zustand zurück.
Doch je mehr Angst ein Mensch vor dem Eingriff hat, desto mehr Ladung nimmt er mit in die Vollnarkose hinein, die aus der Sicht des Nervensystems ein künstlich herbeigeführter Kollaps ist. Dieser nimmt den Stress nicht weg, sondern hält ihn lediglich „unter dem Deckel“. Siehe hierzu auch meinen Beitrag über die Polyvagaltheorie.
Der Stress entlädt sich dann oft nach der Narkose durch Albträume, wildes Gestikulieren oder andere Symptome. Das kann zusätzlich Angst auslösen, vor allem, wenn die Person alleine im Aufwachraum ist.
Insofern ist es essenziell, vor dem Eingriff bestmöglich in die Ruhe zu kommen.
Intraoperative Wachheit
Die Kunst der Anästhesie (Narkose) besteht darin, ein gutes Gleichgewicht zwischen einer ausreichenden Betäubung und der geringsten Belastung durch die Narkosemittel zu finden.
Doch gar nicht so selten, (laut Wikipedia) ca. 1-2mal pro 1.000 Operationen wachen Patienten während der OP auf. Bei Kindern geschieht dies 8–10-mal häufiger. Leider wird darüber in OP-Vorgesprächen kaum bis gar nicht aufgeklärt.
Häufig können die Betroffenen sich dann nicht bemerkbar machen. Dennoch erinnern sie sich an das, was im OP geschehen ist, z. B. auch an Gespräche des OP-Teams. In der Folge können u. a. massive Schlafstörungen auftreten.
Leider wird seitens des Behandlerteams kaum aktiv darüber berichtet. Hier hilft es, nachzufragen oder den OP-Bericht anzufordern, wenn nach der Operation ein seltsames Gefühl zurückbleibt.
Durchgangssyndrom – der schwierige Weg zurück
Ein Phänomen, das gelegentlich nach Vollnarkosen auftaucht, ist das sogenannte Durchgangssyndrom oder postoperative Delir.
Obwohl es zu den häufigsten Folgen nach der Narkose gehört, wird es in vielen Krankenhäusern vernachlässigt und daher auch oft nicht erkannt. Auch wird in der Anästhesieaufklärung meist nicht darüber informiert. Siehe hierzu auch den Artikel Risiko Narkose der Charité.
Es geht oft mit kognitiven Einschränkungen (Vergesslichkeit, Mangel an Fokus), Verwirrung und Angst einher. Viele Menschen erkennen sich nach der Narkose selbst nicht wieder, sind in ihrer Leistungsfähigkeit oft bei Entlassung oder auch noch Monate später eingeschränkt.
Besondere Narkosemittel
Bis in die 1960er-Jahre hinein wurden üblicherweise Äthernarkosen durchgeführt. Diese sorgten häufig für ähnliche Symptome wie eine Vergiftung, etwa Atemnot. Heute werden sie nicht mehr angewendet, und viele der heutigen Narkosemittel werden besser vertragen.
Dennoch wirken Äthernarkosen manchmal bei Menschen nach, die damals operiert worden sind. Zu dieser Zeit bekamen viele Kinder eine Mandeloperation, gelegentlich auch vorsorglich gemeinsam mit dem Geschwisterkind – selbst wenn keine akuten Beschwerden bestanden. Heute wäre es unvorstellbar, so viel unnötiges Leid zu generieren.
Ein weiteres Mittel ist Dormicum, das als Dämmerschlaf oder zur Beruhigung vor Operationen eingesetzt wird, manchmal auch als Beruhigungsmittel in der Notfallmedizin.
Wie auch andere Medikamente aus der Klasse der Benzodiazepine kappt es die Verbindung zwischen bewusstem Gedächtnis und Körpererinnerung.
Die bewusste Erinnerung an die Zeit vor und während der OP wird unterbrochen. Das kann dazu führen, dass ein diffuses Gefühl entsteht, dass etwas nicht stimmt, ohne dass sich die Person an etwas Konkretes erinnern kann.
Technisierte und standardisierte Medizin
In der Schulmedizin gibt es viele standardisierte Abläufe, Diagnosestellungen und Behandlungsschemata. Nicht immer werden diese der Befindlichkeit des Patienten – oder der Patientin – gerecht.
Oft sind auch keine Ressourcen für individuell angepasste Therapien vorhanden. Viele Patientinnen fühlen sich damit nicht ernst genommen oder suchen die Schuld für das Versagen der Methode bei sich selbst.
Dabei ist es vollkommen logisch, dass ein Medikament in identischer Dosierung bei einem 100 kg schweren Handwerker anders wirkt als z. B. bei einer 65 kg schweren Büroangestellten. Im Beipackzettel steht aber häufig nur: Dosis für Erwachsene.
Hinzu kommt außerdem, dass viele Medikamente zunächst nur an Männern getestet werden und bei Frauen anders wirken – Nebenwirkungen inklusive. Beschrieben hat dies u. a. Caroline Criado-Perez in ihrem Buch „Unsichtbare Frauen“.
Leider findet diese Tatsache in der Verschreibung oft keine Berücksichtigung. Die Frauen werden häufig als Hypochonder dargestellt, wenn sie über Nebenwirkungen berichten. Manche davon sind im Beipackzettel einfach nicht aufgeführt. Und die behandelnden Ärzte reagieren entsprechend.
Auch unabhängig vom Geschlecht kann es Unterschiede in der Verträglichkeit von Medikamenten geben, weil manche Menschen unter Anzneimittelunverträglichkeiten leiden. Siehe hierzu auch den (sehr fachspezifischen) Artikel im Ärzteblatt, Arzneimittelunverträglichkeit: Wie man Betroffene herausfischt.
Etwas mehr Vertrauen in das Gespür der Patientinnen könnte hier Abhilfe schaffen und für eine individuell passende Therapie sorgen. Warum dieses Vertrauen oftmals nicht gegeben ist, beschreibe ich in meinem Blogartikel Verwundete Heiler – über die eigene Verletzlichkeit im Heilberuf.
Nicht zuletzt sind viele Therapiemethoden an sich traumatisierend. Ein häufiges Beispiel (aber sicher nicht das Einzige) ist die Krebsbehandlung durch Chemotherapie.
Alternative Therapiemethoden, hauptsächlich außerhalb des schulmedizinischen Bereichs, sind Ärzten oft nicht bekannt. Somit erscheint in der ärztlichen Beratung das Standardverfahren alternativlos. Ungünstig für Patienten, die sich umfassende Beratung und damit Entscheidungsmöglichkeiten wünschen.
Nicht zu unterschätzen ist die negative Auswirkung, die Isolation auf Menschen und ihren Genesungsprozess hat. Während der Corona-Maßnahmen mussten unzählige Menschen ohne die Co-Regulation ihrer Lieben zurechtkommen, was für viele eine massive zusätzliche Belastung bedeutet hat.
Komplikationen – wenn es anders bleibt als vorher
In einigen Fällen erholt sich der Körper nach einer Erkrankung oder Operation nicht wieder vollständig, und es bleiben Veränderungen bestehen. Untersuchungen oder Therapien hinterlassen gelegentlich Narben oder Organschädigungen. Manchmal bleiben auch seelische Veränderungen erhalten.
Je nachdem, wie sehr dadurch der Alltag (und die bisherige Kompensationsstrategie) der Person eingeschränkt ist, kann sich dies auch traumatisch auswirken.
Gelegentlich gilt eine Operation zwar (technisch) als „erfolgreich“, bringt jedoch nicht die erhoffte Verbesserung, und die Symptome bestehen weiter.
Behandlungsfehler
Für Ärzte (und Pflegepersonal) gilt seltsamerweise nicht, was für jeden Lkw-Fahrer Normalität ist: nach einer Arbeitszeit von acht Stunden ist eine längere Pause Pflicht.
Die erlaubte Schichtdauer ist bei Ärzten (durch Dienste etc.) erheblich länger. Durch Krankheitsausfälle werden außerdem auch schon einmal Doppelschichten gemacht. Die Regenerationszeit kommt dadurch viel zu kurz. Damit wird einer Fehleranfälligkeit Vorschub geleistet.
Dies liegt nicht an einzelnen, oft sehr engagierten Ärztinnen und Ärzten, sondern entsteht durch die Organisation des Gesundheitswesens unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit.
Wenn jedoch Fehldiagnosen gestellt und daher nicht die passenden Therapien angeordnet werden, geht dies zulasten der Patienten. Auch nicht erkannte Komplikationen gehören hierher.
Leider fällt es ärztlicherseits (oder seitens der Klinik aus Angst vor Regressansprüchen) oft schwer, Fehler einzugestehen, die Therapie anzupassen und den Patienten umfassend darüber zu informieren.
Häufiger wird das Thema jedoch nicht aktiv angesprochen. Der Patient fühlt sich dann möglicherweise beschämt und sucht die Schuld bei sich. Für Menschen mit frühem Trauma in der Vorgeschichte kann dieser Umgang mit Behandlungsfehlern retraumatisierend sein.
Gerade wenn in den frühen Jahren vieles unerfüllt geblieben ist, kann es schwierig sein, die Identifikation mit der Opferrolle aufzugeben – und damit auch das Gefühl, man hätte von der Welt noch etwas zu bekommen.
Das zu erkennen, kann sehr schmerzhaft sein. Doch der Lohn besteht in dem Gefühl von Selbstermächtigung, wenn du dein Leben in die Hand nimmst.
Stationäre Psychiatrie
Dieser Punkt wird häufig nicht erwähnt, wenn es um medizinisches Trauma geht. Doch auch bei psychisch belasteten Menschen kann eine zusätzliche Traumatisierung erfolgen.
Mehrfach habe ich von Patienten gehört, dass sie die Behandlung auf einer psychiatrischen Station traumatisch erlebt haben.
Menschen in Krisensituationen haben ein sehr dysreguliertes Nervensystem. Dies kann sich nicht immer durch Co-Regulation allein wieder beruhigen. Dann besteht die Therapie hauptsächlich in einer Medikation.
Doch besteht häufig das (instinktive) Bedürfnis, sich in der Not an einen anderen Menschen zu wenden. Verbunden ist dies mit der Hoffnung auf Unterstützung durch eine andere, in sich ruhende und wohlwollende Person.
Die Möglichkeit der individuellen Begleitung ist jedoch häufig nicht (ausreichend) gegeben. Einzelkontakte sind oft sehr knapp bemessen, und die Mitpatienten meist auch sehr dysreguliert.
Hier gibt es eine gewaltige Kluft zwischen der eigenen Verletzlichkeit und Ohnmacht einerseits und der fehlenden Möglichkeit, sich zu regulieren andererseits.
Manche Personen in hochakuten Krisen bekommen ihre Medikamente auch zwangsweise unter Aufsicht oder werden fixiert. Auch wenn es in jenem Moment not-wendend sein mag: Wie wirkt sich das auf die Würde der Betroffenen aus?
Behandlung als Auslöser – Patienten mit Traumafolgen
Für Menschen mit Traumafolgen bergen medizinische Prozeduren die Gefahr einer Retraumatisierung.
Als Folge des Traumas spüren sie sich häufig nicht im Körper und können demzufolge ihre Symptome nicht gut wahrnehmen oder beschreiben. Daher werden sie oft nicht sichtbar. Dies führt leider auch mit dazu, dass sie ihren Behandlungsprozess nicht mitgestalten können.
Hinzu kommt, dass sich insbesondere bei Menschen mit den Folgen von frühem Trauma psychosomatische Symptome zeigen, die nicht messbar sind oder für deren Häufigkeit oder Heftigkeit es rein medizinisch keine schlüssige Erklärung gibt. Zumindest, solange das persönliche Erleben der Patienten keine Berücksichtigung findet.
Dies kann bei Ärzten und Pflegepersonal Hilflosigkeit hervorrufen. Nicht selten werden diese Patienten als Simulanten hingestellt, wenn die Ärzte ihre eigene Ohnmacht als Kränkung erleben, weil sie keine klare Diagnose stellen können. Siehe hierzu auch den Artikel Trauma: wenn die Medizin kränkt im Ärzteblatt.
Wenn es körperliche oder sexuelle Gewalt in der Vorgeschichte gibt, können auch Routineuntersuchungen oder -eingriffe zum Auslöser einer Retraumatisierung werden. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sie die Körperregion betreffen, die damals verletzt wurde.
Weil Menschen in früheren Gewaltsituationen zum Schweigen gebracht wurden, haben sie auch heute oft Schwierigkeiten, Behandlern gegenüber Grenzen zu benennen – und ertragen – wieder einmal – die Prozedur.
Oder sie lassen sich mit einer abweisenden Antwort des Behandelnden wieder zum Schweigen bringen. Immer wieder höre ich, dass sie nicht sauber aufgeklärt wurden oder ihre Bedenken nicht besprochen, sondern abgewiegelt wurden. Doch wer nicht gelernt hat, dass er Antworten bekommt, fragt oft auch gar nicht nach.
Ich wünsche mir sehr, dass Ärztinnen und andere Behandler hierfür besser sensibilisiert werden. Denn entspannte Patienten haben deutlich bessere Heilungschancen.
Hier könnte es helfen, eine mögliche Traumavorgeschichte im ersten Gespräch ebenso zu erfragen wie körperliche Erkrankungen.
Folgen von medizinischem Trauma
Als Folge von (medizinischem) Trauma fehlt den Betroffenen häufig das Vertrauen in den eigenen Körper, und sie nehmen innerlich Abstand von ihrem inneren Empfinden.
Dies kann durch Depression, Abstumpfen und Dissoziation geschehen, aber auch durch spirituelle (Um-)Wege, die den Geist über den Körper stellen.
In anderen Fällen entwickeln sie ein Frühwarnsystem für mögliche neue Symptome, mit (Krankheits-)Ängsten bis hin zur Hypochondrie. Auch Flashbacks oder Albträume können sich zeigen.
Weil das Vertrauen in Ärzte und Behandlerinnen beeinträchtigt sein kann, werden häufig Nachsorgeuntersuchungen vermieden. Dadurch ergibt sich ein erhöhtes Risiko, nicht ausreichend versorgt zu werden.
Menschlichkeit im medizinischen Alltag, Orientierung und Mitbestimmung sind wichtig für die Prävention von Traumafolgen.
Anya Lange
Medizinischem Trauma vorbeugen
Das A und O einer möglichst entspannten Behandlungssituation ist eine gute Orientierung. Diese ist in Notsituationen nicht immer möglich, doch bei geplanten Eingriffen in der Regel machbar.
Hierzu gehört in jedem Fall eine gute Erfassung der Gesamtsituation des Patienten, also auch die Berücksichtigung einer möglichen Traumavorgeschichte. Diese sollte nicht ins Detail gehen, kann aber Hinweise auf mögliche empfindliche Punkte der Patientinnen geben.
Es ist wichtig, dass Menschen mit dieser Befindlichkeit sichtbar werden dürfen (nicht müssen) und nicht stigmatisiert werden, insbesondere in einer Situation der erhöhten Verletzlichkeit.
Ich kann nicht oft genug betonen, wie wesentlich es ist, dass Behandler eine traumasensible Haltung und einen Blick entwickeln, der über die rein somatischen Symptome hinausgeht. Hierzu wäre es wichtig, medizinisches Personal traumasensibel zu schulen.
Wichtig ist ebenso eine sorgfältige Patientenaufklärung über den bevorstehenden Eingriff, seine Möglichkeiten und Grenzen. Hierbei ist es wichtig, dass der Patientin Möglichkeit gegeben wird, Fragen zu stellen.
Das Ziel bei alldem ist das größtmögliche Empfinden von Sicherheit in einer verletzlichen Situation.
Eine kanadische Studie hat gezeigt, dass es seltener zu postoperativen Komplikationen kommt, wenn mindestens ein Drittel der im Operationssaal Anwesenden Frauen sind. Eine gewisse Geschlechterausgewogenheit im OP scheint sich also positiv auf den Heilungsprozess auszuwirken.
Hilfreich ist es, wenn die betroffene Person von vertrauten Menschen umgeben ist. Diese Co-Regulation hilft ihr, besser mit der Situation zurechtzukommen. Doch auch die Angehörigen brauchen Begleitung, sich in ihre unterstützende Situation hineinzufinden, und sollten entsprechend aufgeklärt werden.
Ebenso essenziell ist es, dass die Patienten Vertrauen in ihren eigenen Körper haben und sich nicht scheuen müssen, seine Botschaften dem Behandlerteam mitzuteilen.
Lösungsansätze
Wenn durch Krankheit oder medizinische Eingriffe die Sicherheit im Körper verloren gegangen ist, gilt es, dieses Empfinden wieder zu etablieren.
Körper(psycho)therapeutische Verfahren können hier hilfreich sein, um der Erinnerung des Körpers zu lauschen und die Erfahrung von Krankheit oder Behandlung zu integrieren.
Dies ist besonders hilfreich, wenn es um Geschehnisse geht, während derer die Person bewusstlos oder in Narkose war. Denn der Körper erinnert sich an das ganze Geschehen, auch wenn es der Verstand nicht tut.
Ebenso wichtig ist ein weiterer, sicherer Rahmen durch wohlwollende Menschen in der näheren Umgebung. Durch deren Co-Regulation kann das gestresste Nervensystem der Klienten wieder ins Gleichgewicht kommen.
Wenn ein diffuses Gefühl des Unbehagens bleibt, können Informationen wie die Krankenakte oder der OP-Bericht angefordert werden. Oft geben sie Klarheit darüber, was geschehen ist. Damit kann dann auch therapeutisch weitergearbeitet werden.
Wenn wieder mehr Orientierung entsteht, kann dies auch zu mehr Sicherheit im eigenen Körper und zum Vertrauen in seine Botschaften führen.
Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Artikel wertvolle Informationen über Trauma im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen geben.
In meiner Praxis arbeite ich immer wieder mit Erwachsenen, die als Kinder allein im Krankenhaus waren. In meiner Generation gibt es viele Menschen, die über solche Erlebnisse berichten. Meistens hat das eine tiefe Prägung hinterlassen und wirkt auch heute noch in viele ihrer Lebensbereiche hinein.
Wenn du selbst die Folgen von medizinischem Trauma trägst und beim Lesen den Impuls bekommen hast, dich von mir auf deinem Heilungsweg begleiten zu lassen, schau dir gerne mein Angebot zur traumasensiblen Prozessbegleitung und Traumatherapie an.
Bildnachweis
Arzt mit Stethoskop – Igor
Kranker Teddy –