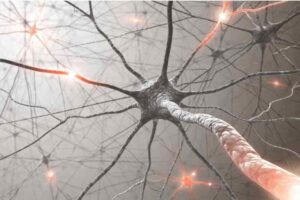Viele Menschen vermissen Verbundenheit und Lebendigkeit in ihrem Leben. Sie fühlen sich einsam und unzufrieden oder nicht zugehörig. Sie sind in ihrem Körper nicht zu Hause – und das generiert ein Gefühl der Isolation und Einsamkeit.
Häufig sind es nicht die äußeren, sondern vor allem die inneren Umstände, die den Körper als sicheres Zuhause unbewohnbar machen. Das eigene Erleben von Stress und Trauma spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie wir unseren Körper wahrnehmen.
Gerade den Menschen, die früh in ihrem Leben hohem Stress und Trauma ausgesetzt waren, fällt es schwer, sich in ihrem Körper zu Hause zu fühlen. Oft beschreiben sie, mit einem Fuß in der Welt zu sein und mit einem Fuß woanders.
Was sie leider nicht erlebt haben, ist ein herzliches und liebevolles Willkommen in der Welt.
Wie geschieht Verkörperung?
Wenn ein Baby geboren wird, braucht es das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, damit es sich auf dieser Welt willkommen fühlt und auch gut im Körper ankommen kann. Diese Sicherheit entsteht durch ein eingestimmtes und liebevolles Umfeld.
Wenn so die Bedürfnisse des Kindes ausreichend erfüllt werden, kommt beim Kind die Botschaft an: „Schön, dass Du da bist.“ Es empfindet dann ein Wohlgefühl im Körper, das mit Ausdehnung und Lebendigkeit einhergeht. Und auch damit das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – und richtig so, wie es ist.
Leider erleben viele von uns etwas anderes, und unser Willkommen auf der Welt fühlt sich nicht so uneingeschränkt an. Was geschieht, wenn ein Kind diese wohlwollende Annahme nicht erlebt hat? Oder wenn ein Erwachsener immer wieder in Stress gerät?
Was bedeuten Stress und Trauma im Körper?
Wenn seine Bedürfnisse nicht (ausreichend) erfüllt werden, gerät das Kind unter Hochstress, denn es ist auf seine Bezugspersonen angewiesen. Dieser Stress geht mit unangenehmen Empfindungen im Körper einher.
Dazu müssen nicht unbedingt extreme Situationen geschehen. Subjektiv empfindet es beispielsweise ein kleines Kind als bedrohlich, wenn es alleingelassen wird, also z.B. im Nebenzimmer schlafen gelegt wird.
Ein erwachsener Mensch kann wiederum von anderen Situationen überwältigt sein, z.B. dem Verlust eines nahestehenden Menschen oder des Arbeitsplatzes.
Was in beiden Fällen geschieht, ist das innere Gefühl der Bedrohung, Überwältigung und Hilflosigkeit. Das Nervensystem geht also in den Überlebensmodus.
Stressmanagement durch „eingefrorene Gefühle und Handlungen“
Um mit dem Gefühl der Überwältigung klarzukommen, „portioniert“ das Nervensystem die Erinnerung in einzelne Fragmente, damit die Situation handhabbarer und aushaltbarer wird. Selbst wenn die Fragmente aus dem bewussten Gedächtnis abgespalten (dissoziiert) werden, werden sie dennoch im impliziten Gedächtnis, also im Körpergedächtnis abgelegt.
Auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr bewusst daran erinnern können, was geschehen ist: Sämtliche unserer Erinnerungen – angenehme und weniger angenehme – sind in unserem Körper gespeichert.
Wenn es zum Beispiel in einer Familie nicht erlaubt war, Ärger zu zeigen, kann es sein, dass ein Kind seine Wut unterdrückt. Die Energie für den Impuls, die Wut auszudrücken, z.B. die Stimme zu erheben und zu schreien, wird in der Stresssituation im Körper bereitgestellt.
Da das Kind sie aber nicht ausdrücken kann, um die Liebe der Eltern nicht zu verlieren, wird dieser Impuls im Körper „eingefroren“. Er bleibt dort, bis die Wut irgendwann (oft viele Jahre oder Jahrzehnte später) gespürt und ausgedrückt werden kann. Nur die Spannung im Kiefer weist evtl. auf die gehaltene Energie hin.
Der Körper sucht aber für den Ausdruck der Energie einen Weg, häufig über Symptome. Möglicherweise zeigt sich dann die ungelebte Wut durch nächtliches Zähneknirschen.
Wenn Wut noch weiter dissoziiert wird, können Menschen auch dann noch lächeln, wenn sie sich eigentlich ärgern. Aber den Ärger spüren sie nicht. Nur ein sensibles Gegenüber ahnt vielleicht, dass etwas nicht stimmt, denn das Lächeln wirkt nicht echt.
Im Körper gehaltener Stress kostet viel Kraft
Die unangenehmen Emotionen und ungelebten Handlungsimpulse im Körper zu halten, kostet eine Menge Energie. Dazu macht sich der Körper eng (die Worte Angst und Enge haben denselben Ursprung) und zieht sich zusammen. Und diese Enge aufrechtzuerhalten, kostet Kraft.
Chronischer Stress beeinflusst den Körper auf allen Ebenen. Weil das innere Gleichgewicht (Homöostase) gefährdet ist, gibt der Körper Alarmsignale an das Gehirn – und beeinflusst damit auch die Psyche.
Ängste, Verspannungen oder Schmerzen und ein Unwohlgefühl im Körper sind die Folge. Viele psychosomatische Symptome sehen aus wie chronisch gewordene Stresssymptome (z.B. Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen). Außerdem ist dauerhafter Stress ein entscheidender Co-Faktor bei der Entstehung vieler chronischer Erkrankungen.
Stress als vegetative Gewohnheit
Manche Menschen mit frühem Trauma sind so sehr an ihren hohen Stresslevel gewöhnt, dass es sich bedrohlich anfühlt, wenn sie in Ruhe kommen. Denn dort kennen sie sich nicht aus.
Sie halten sich dann permanent in Erregung, z.B. durch chronische Aktivität, weil es sich zwar unbehaglich, aber immerhin vertraut anfühlt.
Das hat zur Folge, dass sie kaum noch Kraft schöpfen und auftanken können. Der permanent erhöhte Level an Adrenalin wird zur Gewohnheit – oder gar zur Sucht. Der hohe Energieverbrauch kann auf die Dauer so kräftezehrend werden, dass er in Erschöpfung, Depression oder Burnout mündet.
Ein enger Körper ist kein wohliges Zuhause
Wenn wir uns eng machen, um unangenehme Emotionen und Empfindungen nicht zu spüren, bewohnen wir unseren Körper nicht. Damit schneiden wir uns gleichzeitig aber auch von unserer Lebendigkeit und Freude ab.
Der Körper ist dann kein wohliges Zuhause mehr, sondern wird zum unbelebten Vehikel, das den Verstand spazieren trägt. Der ist dann oft sehr aktiv und kommt nicht zur Ruhe. Dafür wird das emotionale Erleben flacher.
Doch auch Menschen, die Gefühle sehr intensiv wahrnehmen – was sich häufig dramatisch anfühlt – sind nicht unbedingt gut verkörpert. Denn wenn die eigene Kapazität, Emotionen zu spüren, nicht sehr ausgeprägt ist und das Stresstoleranzfenster eher klein ist, können sich Emotionen intensiver anfühlen und schneller überfluten. Die Person ist dann schneller dysreguliert, und der Alarm springt eher an.
Manche Menschen können auch einzelne Emotionen besser wahrnehmen. Vielleicht können sie Trauer oder Ekel (der Körper ist dann eher zusammengezogen) gut spüren, aber sehr ausgedehnte Zustände wie Freude nicht.
Wenn der Körper nicht bewohnt wird
Emotionen in ihrer vollen Kraft – und damit auch Lebendigkeit zu spüren ist also schwierig, wenn wir nicht gut verkörpert sind.
Wenn wir unseren Körper nicht bewohnen, bekommen wir nicht mit, was in ihm geschieht. Damit können wir auch nicht so gut spüren, was wir brauchen, und entsprechend für uns sorgen.
Vielleicht spüren wir auch einzelne Körperteile nicht, die mit Trauma verbunden sind.
Außerdem können wir uns schlechter verorten im Verhältnis zum Raum um uns herum. Das hat zur Folge, dass wir anfälliger werden für Unfälle und Blessuren, weil wir unsere Körpergrenzen nicht spüren.
Der empfundene Abstand zwischen „uns“ und „dem Körper“ bewirkt auch, dass wir ihn nicht mehr als wunderbares Wesen wahrnehmen und wertschätzen. Vielmehr betrachten wir ihn oft als Ding, das zu funktionieren hat.
Wie normal diese Haltung dem Körper gegenüber ist, kann man sich allerorten anschauen.
Symptome gelten nicht als wertvolle Signale des Körpers, dass der Mensch aus der Ordnung geraten ist, sondern sollen schnell verschwinden. Sie werden dann rasch bekämpft, ohne die Ursprünge zu hinterfragen.
Der Körper wird auf vielerlei Art und Weise optimiert, sei es durch Sport, Diäten oder auch Operationen.
All dies als Annäherung an Schönheits- und Leistungsideale, die mit dem wirklichen Leben und echter Lebendigkeit wenig zu tun haben.
Dadurch wird der Körper zum Objekt. Letztlich behandeln wir ihn dann häufig so, wie wir uns selbst als Kinder behandelt fühlten.
Wie wird der Körper zum Zuhause?
Wie wir gesehen haben, ist der Körper auf dem Heilungsweg von Stresskrankheiten und Trauma von zentraler Bedeutung.
Der erste Schritt zu mehr Lebendigkeit ist, dass wir lernen, die Empfindungen unseres Körpers wohlwollend wahrzunehmen und sie willkommen zu heißen. Durch eine offene und neugierige Haltung für seine Botschaften können wir zunehmend unsere Selbstregulation entwickeln.
So wird es immer leichter, die eigenen Empfindungen und Emotionen zu spüren, ohne von ihnen überwältigt zu werden. Die Enge als Abwehr des Körpers weicht einem weiten Körperraum, in dem Platz ist für mehr Freude und Lebendigkeit.
Wenn sich die Spannungen und Enge aus dem Körper lösen, kann es sein, dass Du zeitweise auch unangenehme, zuvor im Körper gehaltene Emotionen spürst. Ich nenne das gerne den „inneren Hausputz“ und behalte den Blick auf ein freies und geräumiges Körperhaus, das da gerade entsteht.
Wenn es mehr Weite im Körper gibt, wird es auch leichter, mit der Wahrnehmung in den Körper zu gehen und ihn zu bewohnen. Du lernst, auf Dein Bauchgefühl zu achten und entsprechend zu handeln.
So kannst Du Deinen inneren Ruheplatz, Deine innere Heimat finden.
Gerne unterstütze ich Dich auf dem Weg in Dein inneres Zuhause. Wenn Du interessiert daran bist, mit mir zu arbeiten, kontaktiere mich gerne. Hier kannst Du ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren.
Bildnachweis
Frau mit Nackenschmerzen –