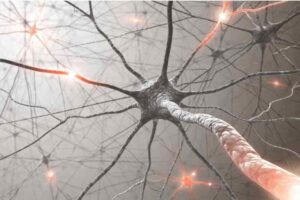Trauma, Sucht und Sehnsucht sind untrennbar miteinander verwoben. Während suchtartiges Verhalten gesamtgesellschaftlich immer mehr zunimmt, wird der Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen jedoch meist nur unzureichend adressiert. Mögliche Gründe hierfür werde ich in diesem Artikel beleuchten.
Sucht kann viele Gesichter haben und zeigt sich nicht nur im übermäßigen Konsum bewusstseinsverändernder Substanzen. Die neueste Serie auf Netflix in Dauerschleife mit anschließendem Schlafdefizit, in Social Media zu versinken, die Chipstüte, die unbedingt geleert werden muss oder das Stück Kuchen am Nachmittag als Muss sind Beispiele für ganz alltägliches und weitverbreitetes Suchtverhalten.
Chronischer Stress durch nicht integrierte belastende Gefühle kann durch einzelne Ereignisse wie Unfälle, OPs etc. ausgelöst werden. Häufig ist es jedoch auch der stete Tropfen mangelnder Einstimmung und Verbundenheit bei frühem Trauma, der den Stein des Urvertrauens in Menschen aushöhlt und sie von sich selbst entfremdet.
In diesem Artikel beleuchte ich die Zusammenhänge zwischen traumatischem Erleben, Suchtverhalten und Sehnsucht, die manchmal leidvoll, manchmal aber auch ein Leitstern für den Heilungsprozess sein kann.
Trauma, Sucht und Sehnsucht – warum eine gemeinsame Betrachtung?
Die Themen Trauma, Sucht und Sehnsucht tauchen oft gemeinsam auf. Viele Menschen mit suchtartigen Verhaltensweisen leiden unter den Folgen von traumatischen Erlebnissen.
Häufig geraten sie über ihre suchtartigen Verhaltensweisen in eine Abwärtsspirale, die sie immer weiter von ihrem ursprünglichen Sehnsuchtsziel – und von sich selbst – entfernt.
Um diesen Zirkel zu unterbrechen, ist es wichtig, die Zusammenhänge zwischen erlebtem Trauma und dem Suchtverhalten zu erkennen. Rein mit Willenskraft und ohne Gespür für die oft leidvollen Hintergründe der Sucht wird Genesung schwierig.
Zunächst möchte ich einmal betrachten, was Sucht eigentlich ist. Dann gehe ich darauf ein, warum traumatische Erlebnisse Menschen anfälliger machen für suchtartiges Verhalten. Zum Schluss betrachte ich mögliche Wege aus diesen Verhaltensweisen – und welche Rolle die Sehnsucht in allem spielt.
Was ist überhaupt Sucht?
Beim Thema Sucht denken wir meist an Alkohol, Nikotin, Kaffee oder Drogen. Doch Menschen können nicht nur vom Gebrauch bestimmter Substanzen (auch Medikamente) abhängig werden.
Auch Verhaltensweisen wie Shoppen, Spielen, bestimmte Arten von Essverhalten oder Scrolling prägen sich als hirnphysiologisch besänftigende Gewohnheiten so tief ein, dass wir irgendwann nicht anders können, als uns immer wieder so zu verhalten – wider besseres Wissen. Unser Verstand ist diesen Gewohnheiten gegenüber dann machtlos.
In diesem Sinne kann alles zur Sucht werden. Auch übermäßiges Arbeiten, Sammeln, exzessiver Sport, Sex oder Romanzen.
Hier weiche ich von der Suchtdefinition in den diagnostischen Manualen (ICD 11 oder DSM V) ab. Dort werden neben substanzgebundenen Süchten auch einige wenige suchtartige Verhaltensweisen beschrieben.
Meines Erachtens ist die Bandbreite von Suchtverhalten jedoch viel größer, als sie dort dargestellt wird.
Sucht als Traumakompensation im Alltag
Suchtverhalten bewegt sich auf einem Spektrum. Die entscheidende Frage ist: dient es wirklich dem Genuss, ist es eine Kompensation von Leid und bist du noch in der Lage, dein Verhalten zu steuern? Oder steuert es dich? Oft ist das gar nicht so leicht zu sagen.
Vielleicht kennst du das auch: Nur noch eine Folge der neuesten Netflix-Serie, obwohl es schon so spät ist. Und wieder bekommst du in dieser Nacht zu wenig Schlaf.
Oder du bleibst zu lange am Handy und scrollst immer weiter, obwohl du eigentlich etwas ganz anderes vorhattest, das dann liegenbleibt. So bleibt die To-do-Liste gleich lang und erzeugt weiter Stress.
Möglicherweise fällt es dir schwer, bei der Arbeit regelmäßig Pausen zu machen und zu regenerieren, obwohl du weißt, dass du dann am Abend vollkommen erschöpft bist – und den Yoga-Kurs an dir vorbeiziehen lässt.
Deine Kraft verbraucht sich in permanenter Geschäftigkeit (auf Englisch sehr treffend Busyholism genannt), und für etwas Erbauliches und Freude schenkendes reicht die Energie dann nicht mehr.
So kannst du auf vielfältige Weisen dein Licht dimmen und deine Kraft mindern.
Zentrale Merkmale der Sucht
Wenn du einschätzen willst, ob es bei deinem Verhalten um Kompensations- oder Suchtverhalten geht, helfen dir vielleicht die folgenden Anhaltspunkte:
- Du hast das Gefühl, bestimmte Dinge zwanghaft tun oder konsumieren zu müssen – und kannst das nicht über den Verstand steuern.
- Im Laufe der Zeit nimmt die beruhigende oder erleichternde Wirkung deines Suchtverhaltens ab.
- Daher machst du mehr vom Gleichen. Mehr Serien, mehr Bildschirmzeit, mehr Shopping, Sport, Alkohol, Zucker, Kaffee oder …
- Im Laufe der Zeit verbraucht das suchtartige Verhalten viel Geld, Energie, Zeit oder Aufmerksamkeit. Diese Ressourcen fehlen dir dann, um deinen Alltag und deine Beziehungen gut zu gestalten. Deine Gedanken kreisen stark um dein Suchtverhalten.
- Wenn du damit aufhörst oder es reduzierst, wirst du unruhig, ängstlich, schlaflos oder gereizt und übellaunig. Entzugssymptome können viele Gesichter haben. Dazu gehören neben körperlichen Stressreaktionen (häufig beim Substanzentzug) auch Veränderungen der Stimmung.
- Also machst du weiter, obwohl du mittlerweile spürst, dass dein Alltag durch dein Verhalten eingeschränkt ist.
- Weil du dich dem zwanghaften Suchtverhalten gegenüber ohnmächtig fühlst, schämst du dich und versuchst, es zu verbergen oder kleinzureden. „Ich hab’das im Griff“, ist eine Standardfloskel vieler Menschen mit Suchtthemen – auch wenn sie leider oft nicht stimmt.
- Noch mehr vom Gleichen zu tun, ist für viele Menschen dann ein Weg, die Scham über das eigene Suchtverhalten nicht zu spüren.
Du weißt genau, was dir guttut und verfällst dennoch immer wieder in die gleichen hartnäckigen (schädlichen) Verhaltensweisen. Das hat etwas damit zu tun, wie dein Gehirn funktioniert und was diese Gewohnheiten darin bewirken. Sie beruhigen das Nervensystem – zumindest kurzzeitig. Auch wenn sie langfristig schaden.
Wenn du wissen willst, wo du auf dem Spektrum Genuss – Kompensation (Sucht) stehst, findest du das am ehesten heraus, indem du mit deinem Verhalten pausierst und dich beobachtest. Geht es dir besser oder schlechter ohne deine Gewohnheit?
„Die Frage ist nicht, warum es so viel Sucht gibt. Die Frage ist vielmehr, warum es so viel Schmerz gibt.“
Gabor Maté, PhD
Sucht und Schmerzkompensation
Generell liegt nämlich jedem Suchtverhalten ein unaushaltbar erscheinendes Gefühl, ein Schmerz, zugrunde. Unser Gehirn unterscheidet hierbei nicht, ob es um ein körperliches oder seelisches Leid geht. Schmerz, gleich welchen Ursprungs, wird im selben Hirnareal verarbeitet.
Intensive und überwältigende Gefühle erzeugen Stress im Körper. Und weil das Nervensystem nicht für längere Stressphasen geschaffen ist, sucht es nach einer – möglichst kurzfristigen – Linderung dieser Gefühle.
Viele abhängig machende Substanzen (etwa Opiate oder Cannabis) sind ihrem Ursprung nach schmerzlindernd. Doch auch verhaltensgebundene Süchte bringen das Gehirn – zumindest kurzfristig – in einen Zustand von Erleichterung.
Welche Strategie auch immer uns dabei hilft, unseren Zustand erträglicher zu machen: Was einmal geholfen hat, darauf greifen wir bei der nächsten Gelegenheit wieder zurück.
Denn wenn die Kompensationsstrategie aufgeht, wird im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Das Glücks- oder Erleichterungsgefühl, das damit einhergeht, motiviert uns dann, beim nächsten Mal wieder dieselbe Strategie zu verfolgen.
Die Verbindung der Nervenzellen, die daran beteiligt sind, festigt sich so mit jeder Wiederholung. Damit automatisiert sich unser Verhalten, und wir entwickeln – mehr oder weniger dysfunktionale – Gewohnheiten.
Kann der Verstand nicht (mehr) regulierend eingreifen, wird die Gewohnheit zur Sucht. Wir machen auch dann weiter, wenn wir wissen, dass uns dieses Verhalten langfristig schadet – weil es uns kurzfristig erleichtert.
Dann hat die Gewohnheit uns im Griff, anstatt dass wir die Gewohnheit haben. Die Grenzen zwischen Genuss und Kompensation oder Sucht sind dabei fließend.
Sucht ist nicht, was du tust oder konsumierst, sondern warum.
Sucht, Nervensystem und inneres Erleben
Wir werden also nicht abhängig von dem, was wir tun oder konsumieren, sondern davon, was dabei in unserem Nervensystem geschieht. Und weil wir glauben, diese bestimmte Strategie zu brauchen, um uns so zu fühlen.
Sucht ist demzufolge ein unkontrollierbares Verlangen nach einem bestimmten inneren Erleben, das nicht über den Verstand zu regeln ist.
Es ist also nicht die Substanz oder das Verhalten selbst, sondern die biophysikalischen Vorgänge im Nervensystem und die Gefühle, die sie in uns auslösen, die süchtig machen. Insofern hat jede Art der Sucht, egal ob substanz- oder verhaltenbasiert, eine körperliche Komponente.
Solange wir nicht lernen, uns zu regulieren und unseren (scheinbar überwältigenden) Gefühlen weiterhin ausweichen müssen, besteht die Gefahr, dass wir eine Kompensationsstrategie nahtlos durch eine andere ersetzen.
Dann kann es sein, dass es etwa gelingt, auf Alkohol oder Kaffee zu verzichten, dafür aber regelmäßig Zucker zu konsumieren oder die Bildschirmzeit zu verlängern. Oder weniger zu arbeiten, dafür aber exzessiv zu sporteln.
Trauma und Sucht
Gerade Menschen, die unter Traumafolgen leiden, sind anfälliger dafür, suchtartige Verhaltensweisen zu entwickeln. Denn sie tragen als Folge leidvoller Erlebnisse, meist in der Kindheit, einen überwältigend erscheinenden Schmerz, eine tiefe Scham in sich.
Je früher oder extremer das Erlebte war, desto größer sind das Leid und die Scham. Häufig scheinen sie so stark, dass sie nicht auszuhalten sind.
Menschen mit frühem Trauma wurden als Kinder nicht ausreichend beruhigt, also co-reguliert. Dieser Mangel an eingestimmter Zuwendung löst bei ihnen das Gefühl aus, es nicht wert zu sein, diese Aufmerksamkeit nicht zu verdienen.
Weil sie damals nicht co-reguliert wurden, ist bei ihnen häufig auch später im Leben das Vermögen, sich selbst zu regulieren (Selbstregulation) und so den Schmerz zu lindern, eingeschränkt.
Da ihnen diese Fähigkeit fehlt, nutzen sie dann häufig die Kompensation über suchtartige Verhaltensweisen oder Substanzen, um mit dem eigenen Leid zurechtzukommen.

Sucht und Schmerz gehören zusammen
Suchtverhalten ist also eine Strategie, nicht aushaltbarem Schmerz zu entkommen – zumindest kurzzeitig. Insofern ist nicht die Sucht selbst das Problem, sondern das darunterliegende Leid.
Solange der Schmerz nicht gelindert wird, kann die Strategie, ihn in Schach zu halten, variieren, und es kommt zur Suchtverlagerung.
Der in Kanada lebende Arzt Dr. Gabor Maté hat sich ausgiebig mit den Zusammenhängen von Sucht und Trauma beschäftigt. Er formuliert das so: Die Sucht beginnt mit dem Schmerz und endet mit dem Schmerz. Es ist ein Teufelskreis der Scham, der mit Sucht einhergeht.
Umgang mit Schmerz in der Suchttherapie
Weil extremer, nicht aushaltbarer Schmerz (häufig die Folge früher Traumatisierungen) das Hintergrundgeräusch jeder Sucht ist, wirken Therapien, die den Schwerpunkt auf das Suchtverhalten selbst legen, oft nicht nachhaltig.
Liegt der Fokus der Therapie hauptsächlich in der Konsum- oder Verhaltenskontrolle und Abstinenz, bleibt das Risiko eines Rückfalls recht hoch.
Werden die Menschen zusätzlich beschämt, isoliert und stigmatisiert (was in unserer Gesellschaft insbesondere bei Menschen mit Substanzmissbrauch häufig vorkommt), verstärkt sich das Leid – und demzufolge auch der Suchtdruck.
Wenn jedoch der Schmerz der Einsamkeit und Isolation hinter der Sucht Raum bekommt, erhöhen sich die Chancen für eine nachhaltige Integration alter Verletzungen.
Gelingt es Menschen, ihre alten Wunden zu heilen und den ursprünglichen Schmerz zu lindern, wird die Notwendigkeit der Kompensation durch Suchtverhalten geringer.
Schmerz durch fehlende Verbundenheit
Was Menschen durch Suchtverhalten zu kompensieren versuchen, ist in den meisten Fällen der Schmerz, der durch einen Mangel an Verbindung, durch ein Gefühl tiefer Isolation und Einsamkeit entsteht.
Johann Hari erklärt das in seinem TED Talk über Sucht (Everything you know about addiction is wrong) sinngemäß so: Wir sind als soziale Wesen dazu geschaffen, uns miteinander zu verbinden. Wenn uns dies nicht mit unseren Mitmenschen gelingt, verbinden wir uns mit etwas anderem, das uns Erleichterung verschafft.
Verbundenheit als Heilungschance
Wenn es gelingt, sich dem eigenen Schmerz (dosiert) zu stellen und ihm nicht mehr ausweichen zu müssen, ist das ein wesentlicher Schritt in Richtung Heilung und Integration.
Was Menschen dazu brauchen, ist das, was damals gefehlt hat, als der Schmerz entstanden ist: die Co-Regulation durch eine eingestimmte, zugewandte Person oder Gruppe.
Wenn wir uns mit anderen verbunden fühlen, können wir auch mit unserer eigenen Kraft im Inneren Kontakt aufnehmen. Dann können Einsamkeit und Isolation sich wandeln in Verbundenheit und ein Gefühl von Heimat – in uns selbst und in der Welt.
Welche Rolle spielt die Sehnsucht?
Viele Menschen mit Traumahintergrund tragen in sich eine tiefe Sehnsucht danach, dass es in ihrem Leben noch etwas anderes geben möge als das, was sie als Kinder erlebt haben – und oftmals auch heute noch erleben.
Häufig ist es diese Sehnsucht, etwa nach gelingenden statt dysfunktionalen Beziehungen, die Menschen motiviert, sich auf die innere Reise zu begeben.
Manchmal kann es im Laufe des Heilungsprozesses auch schmerzhaft sein, zu spüren, dass sie von ihrem Sehnsuchtsziel (noch) entfernt sind. Dieser Schmerz kann sehr heftig sein und ebenfalls anfällig machen für Kompensations- und Suchtverhalten. Wenn er sich zeigt, ist es wichtig, sich gehalten zu fühlen und damit nicht allein zu sein.
Wenn er als „Trauer um das ungelebte Leben“ einen guten Platz bekommt, kann die Sehnsucht als innerer Leitstern den Weg zu mehr Verbundenheit weisen.
Sucht, Beschämung und die Schwierigkeit, sich zu verbinden
Wie wir gesehen haben, sind Scham und ein geringes Selbstwertgefühl häufig der Hintergrund für Suchtverhalten.
Menschen mit suchtartigen Verhaltensweisen wird häufig ein Mangel an Willensstärke oder ein moralisches Fehlverhalten unterstellt – was eine weitere Beschämung darstellt.
Spätestens wenn die Folgen der Sucht sichtbar werden (etwa bei Menschen mit starkem Übergewicht oder Substanzmissbrauch und dessen Folgen), wenden sich viele Mitmenschen ab und distanzieren sich. Vielleicht auch, weil sie durch Mitgefühl für das Leid der anderen an ihren eigenen Schmerz erinnert würden.
Sucht zu stigmatisieren (und zu kriminalisieren), erschwert jedoch für viele Betroffene den Weg zur Heilung. Denn wenn sie ausgegrenzt werden, können sie nicht wieder in die Verbundenheit kommen – die Scham verstärkt sich und verlangt wieder nach Kompensation.
Je verletzter Menschen sind, desto mehr versuchen sie, dem Schmerz zu entkommen. Damit verstärkt sich dann auch die Selbstentfremdung und das Gefühl tiefer Isolation.
Zusätzlich adressieren viele Hilfsangebote die Ursache der Sucht nicht und arbeiten rein auf der Symptomebene (z. B. Weight Watchers bei Übergewicht). Wenn dann der Gewichtsverlust ausbleibt, ist eine häufige Annahme, die Person wäre nicht diszipliniert genug etc.
Die Beschämung durch die Distanzierung bei gleichzeitiger Erwartung, ein unzureichendes Hilfsangebot müsste doch zur Besserung beitragen, bedeutet für viele Betroffene eine scheinbar unlösbare Situation, denn Integration und ein Gefühl der Verbundenheit zu entwickeln, ist so nicht möglich.
Trauma, Sucht und Sehnsucht – gesellschaftlich betrachtet
Die individuelle Heilung von suchtartigem Verhalten setzt das Gefühl von Verbundenheit in einem größeren Rahmen voraus. Wie aber können wir uns miteinander verbinden in einer Gesellschaft, die stark auf Individualismus setzt und in der Menschen sehr isoliert und häufig mehr nebeneinander her- als miteinander leben?
Ein Leitmotiv unserer heutigen Kultur ist die sofortige Bedürfnisbefriedigung und schnelle Erleichterung – durch Konsum jedweder Art. Somit besteht auch gesamtgesellschaftlich ein hohes Suchtpotenzial. Das gibt Menschen generell wenig Gelegenheit, mit den eigenen Emotionen sichtbar zu werden.
Wenn es eine unerwünschte Emotion, also „ein Problem“ gibt, besteht die Unterstützung häufig darin, Menschen so bald als möglich wieder zum Funktionieren zu bringen – mit allen Mitteln. Integration und Wachstum sind so aber nicht möglich und verstärken den Druck nach schneller Erleichterung.
Die Allgegenwärtigkeit der „leuchtenden Vierecke“ trägt ebenfalls dazu bei, dass wir zwar mit unseren Freunden am anderen Ende der Welt, aber nicht mehr mit unseren Mitmenschen nebenan in Kontakt sind.
Die Bilder, welche Werbespots und Influencer in uns wecken, dienen bestenfalls als Konsumanreiz und haben selten etwas mit unseren tiefsten Bedürfnissen nach Nähe und Verbundenheit zu tun. Dennoch appellieren sie an unsere Sehnsüchte.
Die mannigfaltigen Bilder und Videos von glücklichen Menschen und Vorzeigefamilien wecken in uns die Sehnsucht vom (anscheinend) perfekten Leben, während schweigende Paare in Restaurants ihre Smartphones vor das Gesicht halten – und nur einen Meter von möglicher Verbundenheit entfernt sind.

Normal ist nicht unbedingt gesund
Eine Gesellschaft, die kollektiv suchtartigen Kompensationsstrategien folgt, erlaubt Menschen nur eingeschränkt, sich ihren Emotionen zu stellen und sich verbunden zu fühlen. Sie trägt damit eher zur Verstärkung der Isolation als zur Erfüllung unerfüllter Sehnsucht nach Verbindung bei.
Hinzu kommt, dass Menschen in einer Leistungsgesellschaft für Suchtverhalten wie Arbeitssucht oder chronische Geschäftigkeit viel Anerkennung bekommen.
Letztere wird auf Englisch Busyholism genannt. Dass wir im Deutschen keinen entsprechenden Begriff dafür haben, könnte vielleicht damit zu tun haben, dass wir insgeheim stolz auf unsere Dauergeschäftigkeit sind.
Auch Alltagssüchte wie Kaffee, Zucker und Weißmehl werden oft nicht als solche erkannt. Wenn es alle tun, kann es ja nicht so schlimm sein.
Menschen lernen am Modell und brauchen Vorbilder für positives Verhalten. Leider wird dabei häufig der innere Kompass, das eigene Gefühl, übersehen. Dann beginnen Menschen, zu tracken, was sie tun (sollen), statt zu fühlen, was sie brauchen.
Der Boom von Wearables – Fitnesstracker, Smartwatches etc. –, die unsere Vitalfunktionen abfragen und uns etwa sagen, wann wir genug gelaufen sind –, ist Zeugnis davon. Ebenso wie die große Nachfrage an 7-Schritte-Coaching-Programmen, die eine möglichst klare Struktur vorgeben sollen, wo die Orientierung nach innen fehlt.
Statt sich an sich selbst zu und ihren Bedürfnissen zu orientieren, werden sie anfällig für die Scheinbedürfnisse einer konsumorientierten Kultur. Leider verlagern sie dabei den Weg zur Lösung samt der Verantwortung dafür nach außen, anstatt in ihrem Inneren zu lauschen und ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten zu entdecken.
Heilung kann so unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Gabor Maté beleuchtet dieses Phänomen ausführlich in seinem Buch „The myth of normal“ – Vom Mythos des Normalen.
Wie gelingt Genesung?
Schnelle Lösungen, um unangenehme Gefühle nicht zu spüren, sind zur nachhaltigen Integration von Schmerz und Trauma nicht geeignet.
Ebenso wenig hilft es, strikte Programme abzuarbeiten, ohne sich den darunter liegenden Gefühlen zu widmen. Der Schlüssel zur Genesung ist es, die Ursache des Suchtverhaltens zu erkennen und zu beruhigen.
Suchtartige Verhaltensweisen entwickeln sich häufig durch einen überwältigenden Schmerz, durch das traumatische Erleben, zutiefst allein und verlassen zu sein in schwierigen, ausweglos erscheinenden Situationen.
Wenn es gelingt, in ein Erleben von Verbundenheit zu gelangen, kann sich das Empfinden von Einsamkeit Stück für Stück lösen.
„Das Gegenteil von Sucht ist nicht Nüchternheit. Das Gegenteil von Sucht ist Verbindung.“
Johann Hari
Verbundenheit als Schlüssel zur Heilung
Die wohlwollende Präsenz einer anderen Person oder Gruppe kann viel dazu beitragen, dass sich Betroffene mit ihren inneren Nöten nicht alleine fühlen. Das Gefühl, mit dem eigenen Leid gesehen zu werden und damit sein zu können, ist häufig genau das, was damals in der ursprünglichen Situation gefehlt hat.
Menschen sind Bindungswesen und wenden sich instinktiv in ihrer Not an andere – es sei denn, sie haben die Erfahrung gemacht, dass andere Menschen nicht vertrauenswürdig sind.
Dann gilt es, sehr behutsam, dieses Vertrauen wieder zu entwickeln. Wenn das Urvertrauen in andere Menschen sehr erschüttert wurde, ist dies ein häufig kleinschrittiger und langwieriger Weg.
Manchmal gelingt Verbundenheit nicht mit Menschen, dafür aber mit geliebten Tieren, der Natur, der Kunst oder Musik.
Einen Platz, eine Anlaufstelle und ein Gefühl von Zugehörigkeit zu haben, hilft uns auch, den Platz in uns wiederzufinden. Wenn die Ressource der Co-Regulation zur Verfügung steht, wird es auch zunehmend leichter, in die Selbstregulation zu kommen.
Das bedeutet auch, immer mehr in der Lage zu sein, innezuhalten, wenn sich ein unangenehmes Gefühl zeigt, und damit präsent zu bleiben, ohne sofort etwas dagegen unternehmen zu müssen. Mehr zum Thema verkörperte Emotionen findest du in einem eigenen Blogbeitrag.
Sich dem eigenen Schmerz (sehr behutsam und dosiert) zuzuwenden, statt ihn abzuspalten, kann dafür sorgen, dass suchtartige Kompensationsstrategien weniger wichtig werden.
Wenn du spürst, was du brauchst, kannst du eher dafür sorgen, dein ursprüngliches Bedürfnis zu erfüllen. Dann bist du nicht mehr so sehr auf Kompensation angewiesen.
So können wir den Kreislauf von unerfüllter Sehnsucht und Leid, Abspaltung des Schmerzes und Scham unterbrechen. Wir können gelassener auf Alltagssituationen reagieren und mit unseren Mitmenschen besser in Kontakt bleiben. Das verbessert auch unsere Beziehungen.
Je mehr wir uns in uns selbst zu Hause fühlen, desto stärker spüren wir auch die Verbindung mit der Welt. Das bedeutet auch, dass jeder Mensch, der mit sich in Kontakt ist, zu einem größeren Rahmen von Verbundenheit beiträgt.
Ich hoffe, du konntest einen Einblick über die Wirkmechanismen der Sucht und deren Allgegenwärtigkeit gewinnen. Wenn du das Gefühl hast, dich auf deinem Genesungsweg eine Weile begleiten zu lassen, schau dir gerne mein Angebot an.
Bildnachweis
Teenager mit Zigarette und Bierflasche –
Frau verschlingt Kuchen –
Paar mit Handys im Restaurant –